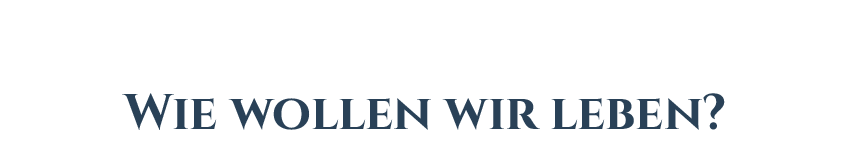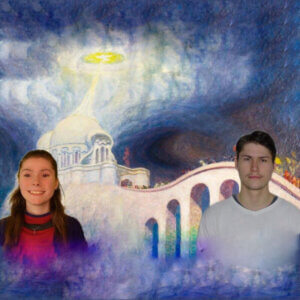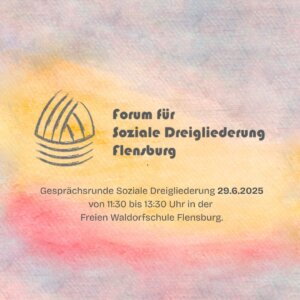Sylvain Coiplet 8.8.2024 Ulrike Stein Teil 1
8. August 2024
https://www.dreigliederung.de/institut
https://www.dreigliederung.de/profile/sylvain-coiplet
Teil 1
Solange ich nicht gesprochen habe, war ich sehr kommunikativ.
Sylvain Coiplet über seine Kindheit und Jugend
„Das wird toll! Da kannst du dich drauf freuen, glaub mir! Und bring genug Zeit mit!“
So entließ mich Matthias, der Veranstalter des Online-Kongresses Zukunftswerksatt – Wie wollen wir leben? Schluss mit Krisen – Neue Wege braucht das Land, in das Gespräch mit Sylvain Coiplet.
Vorher hatte ich auf seiner sehr umfangreichen Website gelesen und den Eindruck gewonnen, dass Sylvain ein sehr stark wahrnehmender, sanfter und musischer Mensch ist.
Das Wetter ist sehr schön an diesem achten August, als ich mein Rad nehme und neunzig Minuten Zeit für den Weg einplane. Ende der 1980er Jahre habe ich in Kreuzberg 62 gelebt und bin von dort aus auch oft in Kreuzberg 36 gewesen, wo sich das Institut für Soziale Dreigliederung befindet. So viele Orte, an denen ich vorbeiradele, tragen ein bisschen von meiner Geschichte, und manches davon kann ich nur schemenhaft erinnern. „So ist das also mit dem Vergessen“, sinniere ich unangenehm überrascht. „Wie wird das in zwanzig Jahren sein?“
Ich sehe das Schild Liegnitzer Straße und mache zehn Minuten Rast auf einer Bank am Landwehrkanal. Kreuzberg hat noch immer ein ganz anderes Gesicht als Charlottenburg – hier lebe ich seit 25 Jahren. Als ich zur Nummer 15 komme, ploppt die Erinnerung an eine Party hoch, die womöglich genau in diesem Haus stattgefunden hatte: Eine Frau erzählte dort von der Ermordung eines Mannes, der sie und ihre Tochter im Zelt in Griechenland, oder vielleicht war es auch Zypern, überfallen hat. Doch wer hatte mich eingeladen? Wo sind die detaillierteren Erinnerungen?
Das Institut für Soziale Dreigliederung befindet sich im zweiten Hinterhof, auf dem man nach links abbiegen und an mehreren Gewerbetoren vorbeigehen muss, im hintersten Eck. Ich drücke den falschen Klingelknopf. Dann drücke ich den richtigen und sofort schaut ein jugendlich wirkender, energiegeladener Mann aus dem Fenster und sagt „Ich komme runter!“ Vertrautheit und Offenheit strahlen von seinem Gesicht und ich wundere mich nicht darüber. Er wirkt wie Mitte dreißig, höchstens, und nicht wie Mitte fünfzig. So ein freundliches und echtes Lächeln sehe ich leider nur selten.
Wir gehen in den ersten Stock des ehemaligen Fabrikgebäudes. Es duftet nach frischem, geleimtem Holz, sehr angenehm. Sylvain hat viele Regale bis hoch unter die Decke gebaut, die schön aussehen und Platz für viele Bücher und auch andere Dinge bieten. Wie setzen uns an einem Tisch gegenüber. Die Ecken des Tisches fehlen, was das Miteinander sehr angenehm macht.
Sylvain spricht mit leiser, schöner sonorer Stimme. „Er arbeitet bestimmt auch irgendwo als Sprecher“, denke ich mir.
„Ich habe auf deiner Website gelesen und den Eindruck bekommen, dass du ein sehr sehr sensitiver Mensch bist“, beginne ich unser Gespräch und ernte sofort eine steile Stirnfalte.
„Sollte ich so daneben liegen?“, frage ich mich, „oder ist das zu persönlich für den Anfang? Aber genau das macht ihn doch fundamental aus!“
Ich wische meine Sorgen beiseite und sage: „So würde ich es bezeichnen: sensitiv.“
„Hmh mhh“, bestätigt Sylvain.
„Sensitiv fühlend, und zwar von klein an. Sensitiv sind vielleicht alle, aber du bist es vielleicht jetzt noch. Und was mich besonders angesprochen hat, ist, dass du mit fünf Jahren von einem Schweigenden zu einer Leseratte geworden bist.“
„Hmh mhh, stimmt.“
„Das heißt, dass du als kleineres Kind eher schweigsam warst.“
„Ich habe gemerkt, dass man mich nicht verstehen kann. Dann habe ich es lieber gleich gelassen. Es konnte mich nur eine Person verstehen und mit der habe ich gesprochen.“
„Eine menschliche Person?“
„Meine Mutter. Die konnte raten, was ich meine.“
„Aah … Dann hattest du eine tolle Mutter, in dem Sinne, dass sie auch das Nichtnormale für wahr genommen hat bei ihrem Sohn, bei dir.“
„Hmh mhh. Ich habe nur eine einzige Silbe gesprochen.“
„Tatsächlich!“
„Das war ein ganzer Satz.“
„Wirklich! Und sie hatte das verstanden! Wie ist das möglich?“, frage ich staunend.
„Das weiß ich nicht.“
„Hat sie denn auch geantwortet oder war es ohne Worte?“
„Sie hat ganz normal gesprochen.“
„Wahnsinn“, flüstere ich, „das ist ja spannend.“
„Deshalb hat sie mich mit viereinhalb aus dem Kindergarten genommen und mit mir begonnen abzulesen. Durch die Unterstützung der Schrift habe ich dann sprechen gelernt. Ich habe alles drei gleichzeitig gelernt: lesen, schreiben und sprechen.“
„Aber du hast ja vorher schon verstanden!“
„Das war nicht das Problem. Das Problem war nur, dass man nicht versteht, was ich sage.“
„Es war ja alles normal und es war keine geistige Behinderung, nur der Ausdruck war sehr speziell.“
„Deswegen sagte ich Sprachloser. Ich hatte nur ein geringes Repertoire an Vokalen und Konsonanten.“
„Hmh mhh … Gibt es dafür auch einen Grund, oder …?“
„Das weiß ich nicht. Ich habe erst vor einiger Zeit erfahren, als ich nachgebohrt hatte, dass ich mit ihr gesprochen habe. Das wusste ich nicht.“
„Das hat sie dann mal erzählt!“
„Ja!“
„Das ist aber schön!“
„Ja. Ich hatte nicht die Erinnerung, dass ich mit ihr gesprochen habe. Aber ich habe die Erinnerung, wie ich mit viereinhalb sprechen gelernt habe. In dem Alter war ich voll bewusst, das heißt ich kann mich erinnern, welches Wort ich in welchem Buch gelernt habe.“
„War es schlimm für dich, nicht normal zu sprechen, sondern mit einer Silbe?“
„Ich habe mich anders verständlich gemacht.“ Sylvain gestikuliert.
„Mit Händen! Also war es keine Isolierung.“
„Ja.“
„Interessant.“ Mein Staunen nimmt kein Ende.
„Und das ist auch geblieben. Vor Kurzem wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mehr mit den Händen rede als mit der Stimme, dass die ganze Kraft eigentlich hier ist.“ Er zeigt auf seine Arme.
„Wer hat das gesagt?“
„Eine Sprachgestalterin in der Schweiz. Sie sagte, wenn ich es schaffen will, hier“, er zeigt auf seinen Hals, „zu sprechen, dann muss ich das hier“, er zeigt auf seine Arme, „zurücknehmen.“
„Das ist interessant! Willst du das?“, lache ich.
„Wenn ich darauf aufmerksam geworden bin … ja!“, schmunzelt er und wir lachen beide.
„… nur dass ich das gar nicht gemerkt habe. Ich dachte, das kommt aus der Eurhythmie, aber es kommt aus der Kindheit. Ich habe mich wirklich so mit allen verständigt, französisch, spanisch, kein Problem. Wenn man mich nach meinem Namen gefragt hat, habe ich auf mich gezeigt.“
„Du hast wahrscheinlich viel vom Herzen aus gesprochen. Die Arme, das Herz und die Kehle gehören ja zusammen. Und viele Menschen sprechen vom Kopf her in die Kehle, und von da nach unten schwingt nicht mehr viel.“
„Wenn ich schon rede … dann ist es … Ja.“
„Und es ist die Frage, für wen es wichtig ist, dass der Ausdruck mit den Händen und Armen weniger wird, damit der Ausdruck mit dem Kehlkopf lauter wird.“ Ich will nicht lockerlassen und suggeriere: „Es ist vielleicht gar nicht so wichtig.“
„Es ist wichtig, weil ich so keine Vorträge halten kann und nur Seminare geben kann.“
„Dafür gibt es doch Mikros.“
„Ja, aber ich kann die veränderte Stimme nicht ertragen. Meine Stimme ist mit Mikro sehr viel höher. Sie ist mir dann zu fremd. Ohne Anlage aber mit Kopfhörer würde es gehen, da gibt es welche, wo die Höhe bleibt. Dann würde es mich nicht stören.“
„Da gibt es bestimmt eine technische Möglichkeit. An und für sich finde ich es nicht wichtig, dass jemand extra laut spricht und seine Ausdrucksart mit dem Körper zurücknimmt, damit das andere mehr ist.“
„Aber ich habe viel mit älteren Menschen zu tun und da braucht es mehr. Die Leute, die Mitte zwanzig sind, haben kein Problem. Das Tiefe ist das erste, was man nicht mehr hört.“
„Ja. Meine Assoziation zu dem Schweigen und Sprachlossein war ganz anders. Es hatte bei dir gar nichts mit innerem Rückzug zu tun.“
„Der Rückzug kam später. Solange ich nicht gesprochen habe, war ich sehr kommunikativ. Aber in dem Moment, wo ich gelesen habe, war der Rückzug da. Da habe ich die Welt gar nicht mehr wahrgenommen. In Nachhinein hatte meine Mutter gedacht, dass sie wohl einen Fehler gemacht hat, dass sie mir das Lesen beigebracht hat!“
Wir lachen.
„In Frankreich fangen die Kinder sehr früh an zu lesen. Das Intellektuelle ist fast Volkskrankheit. Mit sieben habe ich Freud gelesen, den habe ich nicht gemocht.“
„Freud mit sieben!!“
„Aber da habe ich verstanden, was bestimmte Erwachsene komisch macht. Wenn sie daran glauben, ist man als Kind nicht sicher mit denen. Bücher waren für mich da, um die Menschen zu verstehen. Mit zwölf las ich Hesse. Die Jugendlichen und ihre Suche habe ich mit Hesse verstanden.“
„Und mit fünfzehn hast du dann schon Steiner gelesen.“
„Ja.“
„Es gibt nur wenige Menschen, die in dem Alter schon solche Dinge lesen.“
„Was mich beschäftigt hat, wäre für sie völlig fremd gewesen, und das war ein Teil meiner Isolation. Die ersten, mit denen ich wirklich Kontakt aufgenommen habe, waren die Waldorfschüler. Meine Mitschüler an der Staatsschule haben versucht, mir die Noten rauszulocken. Ich habe gesagt: ‚Über Noten rede ich nicht.‘ Dann war ich fertig. Aber die Waldorfschüler hat das auch nicht interessiert. Sie hatten ganz andere Fragen. Das war, als meine Schwester zur Waldorfschule gegangen ist; sie ist zehn Jahre jünger als ich. Deswegen war ich schon in der zehnten Klasse eigentlich. So habe ich Kontakt zur Oberstufenschülern aus ihrer Schule geknüpft, die mein Alter hatten. Zwei haben bei uns gewohnt. Ich bin als Fremdschüler in die Oberstufe reingekommen. Die Schule selber hat mich nicht aufgenommen; die haben mich abgelehnt. Aber ich wollte rein; es hat mir gefallen. Aber es gab ein Veto von einem Lehrer, weil er gemerkt hat, dass ich zum Nachhilfelehrer geworden bin für seine Schülerinnen, und er wollte nicht, dass ich mein Abitur vermassele, weil die so schlecht in Mathe sind. Ich habe gedacht: ‚Wenn er denkt, dass es an ihnen liegt, dann ist es kein Wunder!‘“
„Ja … Und die Schulzeit insgesamt, war die dann eher langweilig für dich?“
„Nein, nicht langweilig. Mich hat alles interessiert. Was für mich schwierig war, war meine Konzentration, dadurch dass ich gespürt habe, dass die anderen das gar nicht wollten.“
„Was wollten sie nicht?“
„Sie wollten nicht da sein.“
„Ja …“, flüsternd, „ja …“
„Also, darunter habe ich gelitten, dass sie eigentlich nicht das machen können, was sie lieber machen würden. Da habe ich sogar mal dem Lehrer gesagt: ‚Warum schickt ihr die nicht auf den Hof – dann können wir arbeiten!‘“
„Oh mein Gott! Du hast mitbekommen und gespürt, dass die anderen darunter leiden, dass sie in der Schule sitzen, und dass sie eigentlich was ganz anderes lieber machen würden, dass sie sich abquälen – was ja auch Usus ist. Du aber brennst darauf zu lernen. Ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass du vom Stoff her schon weiter warst, dass du es schneller verstanden hast und dass es deswegen langweilig war, weil du alles mitgedacht hast und schon das Nächste kennenlernen wolltest.“
„Nee, ich habe andere Sachen für mich studiert dann. Nebenbei. Was nicht in der Schule zu lernen war.“
„Das gibt’s ja nicht!“, lache ich. „Also, du wärest gern mit den Lehrern im Stoff gewesen und schnell und tief durch die Sachen durchgegangen.“
„Zum Teil bin ich im Gespräch mit vielen Lehrern gewesen, weil sie den Eindruck hatten, dass ich mich dafür interessiere, was sie tun. Ich wollte aber nicht, dass es schleimig wirkt, und deswegen habe ich zum Beispiel nicht über Noten gesprochen. Es wusste außer den Lehrern niemand, was für Noten ich habe. Mit einem Lehrer habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, dass sich die Kinder immer weniger interessieren, und dass er gespürt hat, dass es von Jahr zu Jahr runtergeht. Das war einer, der stärker engagiert war. Das waren zum Beispiel Gesprächsthemen. Einem habe ich vorgeschlagen, dass man vielleicht das, was ich neben der Schule studiert habe, machen könnte. Doch er meinte, das stehe nicht auf dem Programm. Da war er für mich eigentlich abgeschrieben. Als Kind kannte ich überhaupt kein Pardon!“
„Und was waren das zum Beispiel für Nebenthemen?“
„Griechische Mythologie.“
„Griechische Mythologie!“
„Ja.“
„Für welches Fach?“
„Der hatte Französisch.“
„Also passte es gar nicht.“
Wir lachen.
„Super! Super! Ja! Jaa! Ich stelle mir das jetzt so vor, dass du eigentlich als Junge und als Jugendlicher darunter gelitten hast, dass das ganze Wissen nicht richtig kam, nach dem du gebrannt hast.“
„Ja.“
„So wie wenn du eine Tomatenpflanze hast. Die wächst da fleißig und die Sonne scheint auch toll, aber es kommen immer nur zwei Tropfen Wasser, und dann hängt sie ganz schnell, hat aber Lust, die Tomaten zu entwickeln! Dann kommen wieder drei Tropfen Wasser, dann geht’s wieder ein bisschen … Dass man verhungert an dem, wer man eigentlich ist. Wenn du jemand bist, der sehr schnell sehr viel wissen möchte und sehr schnell auch lernt, dann brauchst du ja auch entsprechende Lehrer."
"Hmh. Das war sehr schwankend. Es war sehr stark je nach Beziehung – das hat mit dem Alter zu tun. In Frankreich hat man jedes Jahr den Lehrer gewechselt. Das heißt: Ein Jahr ging gut und ein Jahr ging nicht gut. Eine Lehrerin in der dritten Klasse kam aus Kanada, es war ein Austausch.
Sie hatte ihre Sachen von dort mitgenommen. Sie hatte einen ganz anderen Stil. Sie hat nicht gepfiffen, wenn wir in den Hof gehen sollten. Das hat mir gefallen. Die Persönlichkeiten waren sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Die Persönlichkeiten waren für mich wichtiger als das Wissen.“
„Du hast über die Persönlichkeit etwas wahrgenommen und aufgenommen und dann verarbeitet und für dich genutzt.“
„Ich musste spüren, dass die Leute zu dem stehen, was sie tun. Ich konnte keinen Zugang zu konventionellen Lehrern finden. Vielleicht weil meine Mutter unkonventionell war.“
„Es war dir also nicht zu langweilig in der Schule.“
„Nein, absolut nicht. Ich habe nur frei genommen, weil ich selber lernen wollte. So wie in der Mittagspause – da habe ich auch die ganze Zeit nur gelesen.“
„Also hast du deine Freizeit dazu genutzt, sehr viel zusätzlich zu studieren, nicht nur die Hausaufgaben zu machen oder so, sondern ganz viele andere Sachen noch gleichzeitig.“
„Ja. Aber dadurch hatte ich mit den Schülern keinen Kontakt. Mit einigen Lehrern ein bisschen. Und alle haben gedacht, ich würde das studieren, was ihr Fach ist“, er lacht, „aber ich habe mich für ziemlich viel interessiert!“
Ich lache auch: „Oh, das wird mal ein guter Chemiker, das wird mal ein guter Mathematiker …“
„Das ging so bis zum Abitur, das war lustig. Da haben sie gedacht, ich werde Biologe, ich werde Historiker …“
Wir amüsieren uns herzhaft.
„Aber das stimmte wahrscheinlich auch, weil du in den Fächern jeweils so viel erfasst hast.“
„Hmh mhh.“
„Heutzutage würde man sagen hochbegabt.“
„Eigentlich ist es für mich eher hochverliebt. Sachen, die ich liebe, vergesse ich nicht. Was im Unterricht gesagt wurde, war drin, weil ich mich damit verbunden habe.“
„Weil es dich wirklich vom Herzen her, von deiner Liebe her, betroffen hat, deswegen konntest du ganz viel weiter dazu lernen.“
„Ansonsten haben sie gedacht, dass ich begabt bin, aber ich habe auch massiv gearbeitet. Sie hätten nicht ahnen können, wieviel ich da arbeite. Es war nicht Begabung in dem Sinne, dass es leichtfällt.“
„Wieviel ein begabter Mensch für seine Begabung tut, können viele gar nicht nachvollziehen. Begabung heißt ja nicht, dass es von alleine geht.“
„Ich habe immer versucht zu messen. Zwei Wochen kann ich fehlen, so dass ich den Stoff noch nachholen kann.“
„Ah!! So lange hast du dann Freizeit gemacht!“
„Ja.“
„Cool!!“
„Ich hatte ein paar Schüler, deren Aufzeichnungen verlässlich waren, und so konnte ich das gut nachholen.“
Wir kichern wie zwei Teenies.
„Und das konntest du ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell nachholen und du hast es auch gerne gemacht. Die anderen hätten sich gequält und hätten es gar nicht geschafft oder hätten ein Fünftel geschafft und zwei Wochen später hätten sie es schon wieder vergessen – so ist das normale Lernen – das ist ja gar kein echtes Lernen. Das ist ja fantastisch! Das ist ja ein Supersystem gewesen!“
„Ich habe eigentlich nicht gelitten.“
„Ja! Du hast dir das sehr gut eingerichtet!“
„Bis zuletzt war ich interessiert genug, dass es für mich keine Last war.“
„Ja! Und deine Mutter hat auch mitgemacht. ‚Ok, dein Schnupfen ist kaum zu sehen …‘“
Sylvain lacht.
„‘… aber ich verstehe schon: Bleib Zuhause!‘“
„Sie hat damit angefangen. Sie hat mich morgens nicht geweckt, weil sie die Schule nicht gemocht hat.“
„Echt?? Toll!“
„Das war für mich die absolute Katastrophe anfangs. Ich wollte lernen und sie meinte, dass man das eigentlich nicht braucht. Mit der Zeit habe ich was daraus gemacht.“
„Ah, ach so war das. Das Fiese war, dass sie es gemacht hat, ohne es mit dir abzusprechen.“
„Genau.“
„Sie hat dir im Grunde genommen das, was dir wichtig ist, nämlich zur Schule zu gehen, weggenommen.“
„Hmh.“
„Das ist nicht fair.“
„Aber trotzdem kann man das zum Guten wenden.“
„Ja, du hast es ja auch zum Guten gewendet, und ich glaube, in ihr war auch eine gute Absicht. Sie hat ja mitbekommen, wer ihr Sohn ist.“
„Genau. Sie hat irgendwas versucht, dass ich nicht so einseitig werde. Die Schule war für sie sehr brutal. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie, und ihr Vater ist mit zehn aus der Schule raus, aber er hat sie abgefragt, das Wörterbuch. Er war in der Armee gewesen und dort zuständig für die Bibliothek. Er war der Einzige, der sich dafür interessiert hat. Sie hat geistiges Interesse mitgenommen, aber da war keine Nahrung. Deswegen haben wir die Sachen eher fast gemeinsam entdeckt. Hesse war ihre Initiative. Ich hatte eigentlich einen Stapel Bücher. Ich hatte immer hundert. Ich konnte einmal im Jahr Bücher einkaufen und die habe ich mit meinem Vater gebraucht gekauft, und dann hatte ich meinen Stapel. Und sie hat Demian von Herrmann Hesse dazwischengeschoben und gesagt, dass ich nur weiterlesen darf, wenn ich das Buch gelesen habe, was sie grade gelesen hatte.“
„Hat deine Mutter gesagt!“
Wir lachen.
„Warum hat sie das gemacht?“
„Ich war zwölf. Sie hatte es gelesen und dachte, dass ich es mal lesen soll. Sie hat alles nachgeholt, was sie in der Kindheit nicht hatte. Dann habe ich den Stapel nicht weitergelesen, sondern Herrmann Hesse ganz gelesen. Der Stapel hat mich dann nicht mehr interessiert.“
„Und hat dein Vater dir denn die Möglichkeit gegeben, 99 Hesse-Bücher in demselben Jahr noch …“
„Einige hatte meine Mutter schon gekauft. Den Rest habe ich dann nachgekauft. Rückwirkend konnte ich verstehen, was diese Jugendlichen in sich getragen haben, was sie treibt, was sie suchen. Die Suche nach etwas, von dem man nicht weiß, was es ist.“
„Und das hast du auf die anderen bezogen und nicht so sehr auf dich.“
„Ja. Und es war in den 1970er Jahren Mode, Herrmann Hesse zu lesen.“
„Ich wurde 1963 geboren und habe Hesse später gelesen, nicht mit 12, so wie du. Und ich hatte den Eindruck, die anderen sind für diese feineren Gedanken oder Suchen und Empfindungen gar nicht bereit; die ticken ganz anders, die sind materialistisch drauf. Die Leute um mich rum waren eher tumb und stumpf und ganz auf das Äußere bezogen und auf Statussymbole und so. Ich habe da mein eigenes Innenleben wiedererkannt und eben gerade nicht das der anderen.“
„Ok.“
„Und du hast aber erkannt, was in den anderen Mitschülern vorgeht.“
„Nicht den Schülern, den Jugendlichen. Bei uns hat eine Tante gewohnt, die acht Jahre älter war als ich, die Schwester meiner Mutter. Sie hat sie aufnehmen müssen, weil sie sich mit ihrer Mutter gestritten hatte. Meine Mutter hat darauf bestanden, dass jeder, der mit ihrer Schwester zu tun hat, zu uns kommen und sich vorstellen muss. Es waren so zehn zwanzig Jugendliche; die waren immer wieder da. Sie waren sechszehn bis einundzwanzig Jahre alt.“
„Du hattest den Eindruck, dass es in diesen konkreten Menschen lebt. Und hattest du auch den Eindruck, dass diesen Menschen bewusst ist, dass es in ihnen lebt?“
„Das wusste ich nicht. Ich habe es als Stimmung gespürt.“
„Vielleicht gab es ja mal ein Gespräch …“
Sylvain schweigt ein paar Momente.
„Ich habe sehr wenig gesprochen“, er lacht, „eher wahrgenommen.“
„Du hast aber gehört, was sie untereinander sprechen.“
„Die brauchten nicht zu reden. Das war so eine Stimmung.“
„Wahnsinn! Deswegen habe ich gesagt: feinfühlig und sehr sensitiv. Das habe ich gedacht. Ich komme zu Sylvain und der ist sehr feinfühlig und sensitiv. Und das bestätigst du mir durch das, was du mir bis jetzt erzählt hast. Oder würdest du selber das gar nicht so sagen?“
„Dadurch dass ich so viel gelesen habe, habe ich gedacht, dass ich gar nichts wahrnehme. Erst wenn ich mich näher damit beschäftige, merke ich, dass ich zum Teil nicht kommuniziert habe, weil ich so empfindlich war.“
„Später, im Rückblick.“
„Ja. Gerade weil meine Mutter gesagt hat, dass ich vorher alles wahrgenommen habe, bevor ich angefangen habe zu lesen, hat mir bestätigt, dass es angelegt war. Ich habe Sachen wahrgenommen nicht so über Wörter, sondern wie die Menschen eigentlich sind.“
„Sehr still zu sein und gleichzeitig sehr wach in der Wahrnehmung, das ist mir vertraut. Und vieles wahrzunehmen, was andere nicht wahrnehmen.“
„Wenn man zu viel redet, kann man nicht wahrnehmen. Wenn man still ist, kann man besser wahrnehmen. Mein Ideal mit zwölf war – ich habe sehr viel die Kulturen studiert – die Fähigkeit zu besitzen, ein Chamäleon zu sein und immer die Farben zu wechseln und jede Kultur von innen mitzumachen. Deswegen war es nicht so, dass ich sagte, dasunddas ist meine eigene Farbe.“
„Du konntest dich in alles Mögliche hineinversetzen, denkend, aber auch fühlend.“
„Hmh.“
„Das ist Engel Michael.“
„Das ist das, was mich bei der Anthroposophie dann angesprochen hat. Vorher habe ich alles, was Christentum ist, gemieden, weil es für mich moralisch und korrupt war. Wenn jemand etwas Gutes tut, damit er später bessere Karten hat?! Also, das geht für mich nicht.“
Wir lachen.
„Es ist völlig klar, dass das für dich nicht geht.“
„Aber was Steiner unter Christentum verstand, mit dem Interesse für die Unterschiede und wie jeder denkt, das Christliche eher fließend, das Persische, das Buddhistische, wenn das das Christliche ist, dann okay.“
„Michael unterstützt uns ja auf dem Weg zum Weltbürgertum. Tatsächlich sich vorstellen zu können, dass zum Beispiel ich genauso gut ein dunkelhäutiger Mann sein könnte, der in Sansibar sozialisiert wurde, oder eine muslimische Frau in der Sahara. Zu spüren, dass man selber auch diese Kultur haben könnte.“
„Das gehört zu den Sachen, die ich mitbringe.“
„Wir könnten auch das andere sein. Es trennt uns nicht. Und trotzdem ist es wichtig, der individuelle Mensch mit seinen Wurzeln zu sein. Du hast französische Wurzeln, bist aber relativ früh nach Deutschland gegangen, wegen Steiner.“
„Ja. Das Ideal hatte ich mit zwölf und das Individuelle ist erst später gekommen. Zu der Zeit bin ich nicht wirklich individuell gewesen. Gerade durch dieses Eintauchen-Wollen habe ich vielleicht die Beweglichkeit gehabt, aber das Individuelle war nicht so mein Ziel.“
„Also … Das Du-Werden in deiner Kindheit und Jugend ist sehr stark gekommen durch das viele Einfühlen in andere Menschen, Themengebiete, Fächer, Kulturen, Religionen und so weiter. Durch das viele Eintauchen und das Mitnehmen von vielen vielen vielen Dingen – das ist ja bei dir verglichen mit anderen jungen Leuten extrem viel – dadurch ist vielleicht auch deine Identität …“
„Ich hatte den Eindruck, ich kann mich nicht verlieren, deswegen kann ich wirklich eintauchen. Das Ichhafte ist für mich erst in Deutschland gekommen. In den letzten Jahren in Frankreich sah ich in den Augen der anderen sehr individualistisch aus, weil ich sehr sonderbar war. Aber das war gar nicht so, wie es sich angefühlt hat.“
„Du hast dich dann auch gar nicht so sehr mit deinen Wurzeln identifiziert.“
„Das Individuelle war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es ein zweites gibt davon. Deutschland war schon ein Schlag für mich.“
„Und dann bist du Ich.“
„Ja. Vorher war die Selbstlosigkeit so stark in der Art, eintauchen zu wollen und mitzufühlen, da konnte ich das nicht von mir behaupten.“
„Das ist ja ganz stark so bei den Bodhisattvas. Die Bodhisattwas, die einmal ein Buddha werden. Da geht es ja ganz viel um das Mit- und Einfühlen in das Leiden anderer. Das hast du ja dann schon ganz stark mitgebracht.“
„Deswegen war Konkurrenz für mich undenkbar. Das Portrait von Dürer war für mich der Einschlag für das Ichhafte. Wie eine Lemniskate von außen zur Mitte hin.“
Sylvain zeichnet sie vor seinem Herzen in die Luft. „Und dann baff. Und im Nachhinein merke ich: Die Philosophie der Freiheit habe ich zwar schon mit achtzehn gelesen, aber ich war noch Kantianer. Es hat noch einige Jahre gebraucht, bis es Wurzeln gefasst hat.“
„Ich glaube, ich verstehe es. Denn deine Wahrnehmungs- und Handlungsbewegung ging nach außen.“ Ich zeichne Linien auf den Tisch, die von der Mitte nach außen gehen.
„Genau.“
„Nach außen, aber auch so“, ich zeichne eine Kurve nach innen bei jeder Linie, „denn du hast ja was genommen, nach innen, ganz viel.“
„Hmh mhh. Und das Grünschwarz auf dem Bild hatte auch irgendwie damit zu tun.“
„Dass man auch den Fokus auf dieses Mittlere legen kann. Und hatte es auch mit typisch deutschen Lebenseinstellungen zu tun?“
Die Fortsetzung folgt im nächsten Newsletter:
Teil 2 Ich muss die Dreigliederung vor ihnen in Schutz nehmen.
Sylvain Coiplet über sein Wirken
von Ulrike Stein