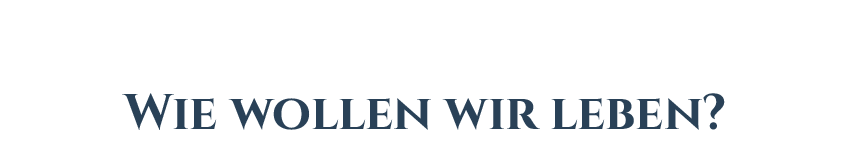Gespräch mit Sylvain Coiplet im Institut für Soziale Dreigliederung Berlin
8. August 2024
https://www.dreigliederung.de/institut
https://www.dreigliederung.de/profile/sylvain-coiplet
https://www.dreigliederung.de/publish/grundfragen-der-sozialen-dreigliederung
von Ulrike Stein
Teil 3
Seit dem Sozialen muss man im Kreise denken.
Sylvain Coiplet über Arbeit/Bildungsbürgertum/Organismus/Vergleich
„Es tut gut … Weil die Erfolge und das Verständnis zu sehen sind.“
„Ein Punkt, den man nicht so gut verstehen kann, wenn man bürgerlich geprägt ist, ist der, wenn
Steiner über Arbeiter spricht. Das wurde eigentlich immer ins Gegenteil verkehrt. Zum Beispiel, dass man möglichst Geld kriegen sollte, um das machen zu können, was man für richtig hält; wenn man denkt, dass die Welt das braucht. Das ist für mich typisch für diese Prägung.“
„Aus meiner Sicht ist das ein typisch kapitalistischer Gedanke.“
„An dem Punkt ist es ähnlich, he?!“
„Es ist etwas Soziales drin, wenn man eine gute Absicht hat, aber mit einem natürlichen Kreislauf hat es ja gar nichts zu tun.“
„Ja. Steiner meint, es war früher so, dass man damit weitergekommen ist, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Handwerk. Aber ab der Industrialisierung ist es nicht mehr so. Das heißt, es geht gar nicht darum, was du gern machen würdest, sondern darum, was gebraucht wird. Es muss überhaupt nichts damit zu tun haben. Das kommt bei den Leuten gar nicht an. Sie können mit dieser Änderung und mit diesem Ansatz überhaupt nichts anfangen. Da merke ich, wie sich die Prägung auswirkt und sie alles verdrehen, was Steiner dazu gemeint hat.“
„Hast du eine Idee, woran das liegt?“
„Seit zehn Jahren wundere ich mich nicht nur darüber, sondern meine, dass es durch die Prägung kommt. Ich bin am Rätseln, was da zusammengekommen ist. Außer der Prägung ist es auch ein Ideal. Aber ein Ideal, was ein bisschen zu weit geht, nämlich dass das, was ich bekomme, wenn ich etwas für andere tue, nichts damit zu tun haben muss. Das ist eine Form der Selbstlosigkeit. Das Ideal, dass man gar nicht mehr gegenrechnen soll. Steiner meinte, dass man das nur in kleineren Gemeinschaften ausleben kann, die ein gemeinsames Ziel haben und deswegen darüber hinwegkommen, was der eine beiträgt und der andere davon hat. Dass man mehr oder weniger einen gemeinsamen Topf hat. Aber das setzt wirklich voraus, dass man nicht in der Zeit aufgeht, wie sie heute ist, sondern auf etwas vorgreift, was vielleicht später möglich ist. Das steht bei denen sehr stark, und sie merken nicht, dass es nur im Kleinen gemacht werden kann, nicht gesellschaftlich.
Gesellschaftlich muss man genau rechnen, damit es aufgeht, dass jeder wirklich durchkommt. Und diese Haltung, dass man genau rechnen muss, können sie nicht ertragen.“
„Das ist aber dann interessant: ‚Warum kann ich das nicht ertragen?‘ Ich glaube, die Leute haben ganz subjektiv für sich ihren nächsten Schritt. Auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Sie möchten gerne einen nächsten Schritt haben, der etwas besser macht. Und diesen oftmals nicht selbst benannten aber existierenden Wunsch projizieren sie dann auf irgendwas, zum Beispiel auf die soziale Dreigliederung.“
„Ja.“
„Und es ist ja, glaube ich, auch so, wie du eben beschrieben hast: Jemand muss Pianist werden, muss muss muss. Wenn der dieses ‚ich mache, was ich möchte, fühle oder weiß endlich nach 45 Jahren oder so, das möchte ich leben, das ist wichtig für die Welt‘ – wenn der an diesem Punkt steht für sich selbst, weil er nie aus sich selbst leben durfte, sondern immer machen musste, was den Erwartungen entsprach, oder später im Leben Sachzwängen, Familie und so, unterlag, dass er endlich mal, was er spürt, tun kann! Wenn er an dem Punkt steht, dann kann er bei der Dreigliederung erstmal nur so denken.“
„Ja.“
„Er ist noch nicht weiter. Weil dieses Stück für ihn noch ganz wichtig ist im Leben. Wenn er das richtig gelebt hat und integriert hat und richtig weiß, wie es ist, aus sich heraus das Leben zu leben und zu gestalten, dann kann er auch den nächsten Schritt weitergehen und sagen: ‚Ich mache natürlich auch alle möglichen Arbeiten, die mit meinem individuellen Wunsch gar nichts zu tun haben, sondern die einfach jetzt wichtig sind für die Gemeinschaft, die Gesellschaft. ‘Verstehst du, was ich meine?“
„Ja.“
„Die Leute stehen an bestimmten Punkten. Grade die aus dem Bildungsbürgertum sind oftmals so fremdbestimmt und unter Zwängen gar nicht sie selbst. Ganz im Gegenteil zu dir und wie du aufgewachsen bist. Du bist ja sehr du selbst, von Anfang an schon. Das ist ja unterschiedlich, und manche Kinder kommen anders auf die Welt. Deswegen kann manchmal etwas nicht so genommen werden, was du sie unterrichtest, wie es eigentlich gemeint ist.“
„Ich weiß: An der Stelle habe ich noch nicht genug Mitgefühl. Da werde ich bissig.“
Sylvain lacht.
„Weil es nicht sozial ist. Weil es irgendwie egoistisch erscheint. Oder?“
„Ja.“
„Aber es ist nur aus einer Sicht egoistisch.“
„Was für mich in den letzten Jahren klar geworden ist: Steiner beschreibt diese Aufgabe, dieses Brüderliche, in der Form, dass man nicht berechnet, aber als Aufgabe der Anthroposophen unter sich. Das hat nichts mit Dreigliederung zu tun. Davon spricht er schon viel früher. In dem Moment, wo sie anfangen zusammenzukommen, 1904, sagt er immer wieder, dass sie sozial Schlüsse daraus ziehen sollen unter sich. Das ist das, was viele aufgreifen und dann versuchen, damit zu leben, dahin zu arbeiten. Das heißt, was ich hier als Ideal beschrieben habe, wird auch genährt durch Texte von Steiner. Mich hat es nur genervt, weil es meine Arbeit torpediert. Vor einigen Jahren ist mir klargeworden, dass es eine andere Aufgabe ist, die er ihnen da gegeben hat – eine Art Vorgriff auf die Zukunft.“
„Wie eine Übungsphase in einer Insider-Gruppe.“
„Genau.“
„Die auch ihre Berechtigung hat.“
„Genau. Und das kann ich jetzt integrieren: dass es auch seine Berechtigung hat. Vorher habe ich mich nur geärgert. Es passiert immer öfter, dass ich diesen Aspekt ganz am Anfang der Seminare bringe, wenn ich merke, dass das in der Anfangsrunde lebt. Und vor allem betone, dass es seit den 1970er Jahren so stark ist. Das heißt, viele dieser Versuche sind gescheitert. Da ist viel Resignation, dadurch dass man das mit der Dreigliederung verwechselt hat. Sie haben gedacht, dass sie es probiert haben und es ist gescheitert. Ich bringe das dann in der Form, dass ich sage: ‚Was ihr probiert habt, ist eigentlich gar nicht die Dreigliederung. Die ist der nächste Schritt, wenn ihr mal geübt habt. Wenn ihr das nicht geschafft habt, heißt das nichts über die Dreigliederung.‘ So ist es die Überwindung einer Resignation. Und nicht die Überwindung meines Ärgers.“
„Man könnte es ja sogar auch reframen, indem man sagt: Zum Glück ist es gescheitert, weil es zunächst ein Laboratorium war und letztlich in einen anderen Rahmen gehört. Das Reagenzglas ist geplatzt.“
„Hm, ja!“ Er lacht.
„So bist du ganz aus dem Schneider raus. Wenn es stimmt … Vielleicht liegt es in der Natur der Sache, dass es dort eine Grenze gibt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es nicht klappt.“
„Ja. Ich habe eine Gruppe erlebt, die es vierzig Jahre lang geschafft hat. Ich habe sie erst kennengelernt, als sie auseinandergegangen sind und von mir was hören wollten. Das bestätigt, dass es scheitern muss, damit mit man sich an die Sachen ranmacht, die dran sind. Sie könnten es natürlich wieder versuchen, aber das ist wirklich nicht meine Aufgabe.“
„Den Leuten in deiner Gruppe verleihst du ja Flügel und ermunterst sie, wenn du sagst: ‚Wow, das habt ihr schon gemacht und gelesen, und ihr kennt euch damit schon aus, und natürlich ist es frustrierend, wenn etwas nicht klappt, aber wisst ihr was? Es hat auch was Gutes, denn …‘ und so weiter. Dann öffnen sich die Ohren. Dann gehört das Resignieren in das große Ganze rein als ein wichtiger Punkt.“
„Das wären ein paar Sachen, die in meinen Unterricht reinspielen. Deswegen rede ich viel über Kapital und auch Arbeit. Das gehört immer dazu. Und bei der Arbeit bringe ich das, was Steiner meint, einerseits, was es einem nicht bringen soll, und andererseits den Aspekt, dass man seit der Industrialisierung so wenig verbunden ist mit der Arbeit, dass man sie von außen beschränken muss. Ein Lehrer zum Beispiel denkt immer nach, da kann man nicht einfach Stopp sagen, aber bei der industriellen Arbeit muss man eine äußere Grenze ziehen. Und gerade die, die in ihrem Beruf aufgehen, haben Probleme mit dem Gedanken. Dass sie ihren Beruf behalten können, in dem sie aufgehen, ist gut für sie, aber nicht für das Verständnis, das heute immer wichtiger wird. Oftmals haben sie ihr Leben lang gekämpft dafür, dass sie machen können, was sie für richtig halten.“
„Was ja gut ist.“
„Ja! Aber ich versuche einen Weg zu finden, wie ich ihnen zeigen kann, dass es immer weniger Menschen sein werden. Dass sie aus dem, was sie geschafft haben, nicht schließen können, was gesellschaftlich dran ist. Es ist eine Art des Entdeckens eines fremden Gebietes. Steiner sagt, dass es nicht darum geht, dass der einzelne entscheidet, wann Schluss ist, wie zum Beispiel beim Lehrerberuf, sondern das muss man durch Gesetze äußerlich begrenzen.“
„Könnte man das Erkämpfen des Eigenen nicht als einen Mosaikstein mit hineinnehmen, indem man sagt: ‚Durch deinen Lebensgang hast du dasunddas entwickelt und das ist wichtig für den nächsten Schritt. Der nämlich ganz anders aussieht.“
„Ja.“
„Und ohne deinen Lebensgang, auf dem du dir dasunddas erkämpft hast, wäre es schwerer, den folgenden Schritt zu machen. Dass man den Leuten das nicht wegnimmt und sagt, dass ihr Denken da zu eng sei, weil es so in der Zukunft nicht gehen wird aus denundden Gründen, sondern dass man sagt: Es ist ein wichtiger Teil, den du gelebt hast, den nehmen wir mit rein. Geht das oder ist das von mir naiv?“
„Das weiß ich nicht, denn die Sachen zu finden, bei denen ich produktiv mit dem Widerstand umgehen kann, ist nicht meine Stärke. Für die Leute ist es oft eine Art Befreiung zu merken, dass, wenn man die industrielle Arbeit beschränkt hätte, man sich möglicherweise nicht mehr so kaputtmachen würde, um darum zu kommen. Wenn die Option nicht wäre, acht Stunden in der Fabrik zu arbeiten, sondern zwei bis drei Stunden, dann hätten sie es vielleicht doch nebenbei machen wollen, neben dem, was ihnen wichtig war, und wären nicht am Widerstand fast zerbrochen.“
„Ja. Aber was ist mit den Leuten, die was ganz Tolles aufgebaut haben und merken: ‚Endlich habe ich es geschafft, aus meiner Kreativität heraus tatsächlich was Schönes in die Welt zu bringen!‘ Das kann ja nach Ego klingen, ist es aber nicht unbedingt.“
„Für mich ist es das nicht, weil sonst hätte man keine Lehrer. Das ist so ein alter Beruf, in dem man sich verwirklicht, indem man anderen hilft. Ich habe nur Probleme, wenn sie so einschränken, dass man nicht merkt, dass was dazu gekommen ist, was es vorher nicht gab. Aber die Sachen an sich sind für mich verständlich, und ich habe sogar Kollegen, die ein Bild vom Geistesleben haben, was eigentlich nicht stimmt. Dass sie meinen: Lehrersein ist nur Selbstverwirklichung und man müsse das von außen eingrenzen. Für mich stimmt das gar nicht, weil, wenn du das hast, bist du für die Kinder nicht brauchbar. Man muss ein Mitteilungsbedürfnis haben und nicht nur einfach sich toll finden, und es muss auch um die Kinder gehen und nicht um die Selbstverwirklichung der Lehrer. Bei der Kunst kann ich spüren, wie der Impetus da ist. Das braucht es, weil ich selber im Unterschied zu anderen Kollegen … Ich habe mit ihnen zusammen Dreigliederung studiert und sie haben über Eurythmisten gewitzelt, ohne zu wissen, dass ich das bin. An der Stelle bin ich auch auf beiden Seiten. Ich muss aufpassen, dass mich das nicht verbittert macht. Dass ich deswegen etwas härter und herber bin gegenüber den Künstlern, weil die …“
„… wegen dem Spott.“
„Nein, weil ich selber darauf verzichte, diesen Weg einzuschlagen. Das hätte ich auch machen können.“
„Das machst du aber nicht. Du bleibst dir treu.“
„Die Sachen sind dann erstmal für mich. Ich muss aber aufpassen. Ich habe einen Kollegen, wenn ich über Arbeit rede, sagt er den Leuten: ‚Dass er solche Sachen über Künstler sagt, macht er auch deswegen, weil er selber es nicht macht, obwohl er das gerne gemacht hätte.‘ Das ist ein französischer Kollege und ich glaube, es ist ein bisschen was dran. Durch meinen Tonfall spielt es rein und da muss ich ein bisschen aufpassen.“
„Wo du es selber merkst, geht der Schleifungsprozess weiter. Da sind wir wieder bei dem Du. Wenn der andere das über dich gesagt hat, kannst du dich daran schleifen.“
„Ja.“
„Jetzt habe ich ein bisschen eine Idee vom Wirtschaftsleben und vom Geistesleben und was es nicht ist. Und das Rechtsleben beschränkt die Arbeit und gibt einen starken Rahmen vor.“
„Ja, denn vom Wirtschaftsleben her würde man die Leute völlig durcharbeiten lassen beim Industriellen. Bei den anderen Sachen ist es kontraproduktiv. Bei nicht industriellen Berufen kannst du die Leute nicht mehr arbeiten lassen als sie eigentlich vertragen, weil das Ergebnis dann unbrauchbar ist wie etwa bei der Pflege; die Alten haben dann ihre Probleme damit, wenn die Pfleger zu viel arbeiten und unfreundlich werden.“
„Aber die Leute, die in der Fabrik arbeiten …“
„Da ist es egal, wie sie sich fühlen, es ist brauchbar.“
„Es ist brauchbar und wenn der Mensch nicht mehr kann, wird er wie ein Gegenstand ausgetauscht.“
„Ja. Ich erzähle gern, in China unter den Fenstern bei den Zulieferern von apple befinden sich Netze, weil viele es nicht mehr für lebens- und menschenwürdig gehalten haben.“
„Echt schlimm.“
„Ja. Also haben wir schon die drei.“
„Ja! Ich habe noch eine Frage zum Wirtschaftsleben und dem Nervensystem. Du sagtest, dass es eine Metapher ist. Ein sehr unausgeglichenes Arbeitsleben kann zu einer nervlichen Erschöpfung führen. Somit ist die Ursache-Wirkung-Ebene doch auch mit dabei.“
https://www.dreigliederung.de/publish/postkarte-vergleich
„Das war das mit dem Systemischen, hm? Du meintest, dass es nicht nur um das geht, was man selber tut, sondern dass auch von außen Veränderungen geben kann.“
„Du sagtest, der Vergleich sei gemeint, nicht das Ursächliche.“
„Beim Organismus. Steiner meint alle drei, aber wenn er vom sozialen Organismus spricht, meint er den Vergleich. Er spricht über die Wirkungen von Ausbeutung, aber so kurz, dass ich nicht schlau daraus wurde bisher. Die Soziologie schaut, wie die Umstände sich auf die Menschen auswirken, und sagt: Erstmal setzt der Mensch etwas aus seinem Geist heraus in die Welt, in das Soziale, aber dann ist es da. Dann wirkt es als Gegebenes zurück, so wie die Außenwelt auf einen wirkt. Steiner meint, dass Verschiebungen entstehen, sodass man nicht sagen kann, dass es spiegelbildlich ist. Dass das, was etwas bewirkt, auch wieder ein Echo bekommt, das dann anderswo wirkt. Aber das sagt er nur einmal. Und ich brauche zwei drei Mal, um daraus schlau zu werden. Da spricht er auch über die Auswirkungen von falschen Gesetzen und vom falschen Wirtschaften auf den Menschen, aber komischerweise nicht im jetzigen Leben. Das ist etwas, das man mitnimmt. Steiner nimmt den Vergleich, und das ist eine Reaktion darauf, dass das damals üblich war und dass da problematische Vergleiche waren. Das heißt, er nimmt jahrelang Stellung zu den problematischen. Und dann bringt er den Vergleich selber ins Spiel, aber ganz anders, als die anderen das tun. Wie du eben meintest: Wirtschaft und Nervensystem, da würde man denken, dass das Geistesleben ist. Nervensystem – Kopf. Aber er bringt das auf ganz andere Art. Erstmal musste ich zeigen, wie er auf die Leute eingeht und das Stück für Stück bringt, weil sein Ausgangspunkt damals die Biologen sind, die über Organismus sprechen und dann am Ende ein Kapitel haben über das Soziale. Aber das sind nicht unbedingt sehr soziale Menschen. Ich musste also in dem Werk rechtfertigen, warum er erst kritisiert und es dann aber selber macht, und zeigen, warum es nicht dasselbe ist.Ich habe schon ziemlich früh für mich geklärt, was da passiert ist, aber was für mich neu war, war diese Fragestellung Vergleich – Ursache/Wirkung. Das ist mir erst vor zwei drei Jahren klargeworden, deswegen habe ich die Einleitung erweitert.
https://www.dreigliederung.de/essays/steinerzitate-2-natuerlicher-und-sozialer-organismus
Wenn man nach Wirkung sucht, hat man eher wie in der Antike Kopf – Geistesleben und Gliedmaßen – Wirtschaftssystem. Aber das wäre die Auswirkung des Menschen auf das Soziale; wie es sich abbildet im Sozialen. Da die Antike alles vom Menschen aus gedacht hat, hat sie diesen Aspekt. Und der ist nicht falsch. Und neu ist, dass man mit dem Marxismus andersrum guckt: Wie wirkt sich das Soziale aus? Da spricht Steiner von der Rückwirkung. Es gibt zwei Vorträge, in denen er das beschreibt. Ich gebe nur eine Spur davon, wie man es verstehen kann, weil das nicht in meinem Text steht. Es ist eine Frage der Reife. Erstklässler reden anders miteinander als Zweitklässler Das, was ein Echo macht von außen, ist das, wo eine Verwandtschaft entsprechend der Stufe, in der man steht, besteht. Steiner sagt, das Ich des Menschen ist auf der ersten Stufe zum ersten Mal da und die mineralische Welt ist zum ersten Mal da. Beide haben Echo. Und so macht er das dann mit den drei anderen. Er schaut, auf welcher Stufe sie in ihrer eigenen Entwicklung sind. Deswegen kann der Mensch heute das Mineralische, das Tote, gut verstehen. So ist die Spur, warum man denkt, ich und physische Welt haben nichts miteinander zu tun, aber warum doch in der Wirkung von außen was passiert. Dasselbe benutzt er für die Medikamente. Wenn er sagt, dass das Pflanzliche im Menschen krank ist, dann sollte er die Medikamente nicht bei den Pflanzen, sondern bei den Tieren suchen. Da ist so eine Verschiebung. Seit dem Sozialen muss man im Kreise denken. Man bewirkt das Soziale und das wirkt dann zurück. Abwechselnd Anthroposoph und Marxist.“
Sylvain lacht.
„Eigentlich ist das eine schon das andere und das andere wieder das eine.“
„Nur zeitverzogen, sagt er.“
„In einer Minibruchteilsekunde.“
„Oder eben ein Leben. Das, was wir z. B. in der Architektur haben, ist das, was die Menschen früher gedacht haben. Ich habe mehrere Jahre nicht in Häusern, sondern in Höhlen gelebt. Es war eine Gegend in Frankreich, wo noch im letzten Jahrhundert über achtzig Prozent der Menschen in Höhlen gewohnt haben, weil der Stein das hergibt. Das Vorderteil meines Hauses war Renaissance und das hintere Teil war ausgehöhlt, ganz andere Formen. Man musste sich nach dem Stein richten. Als ich einen Rückblick gemacht habe, hat meine Mutter geguckt, dass wir einige in der Gegend besuchen. Da haben wir nachträglich einen Wald gefunden, in dem es fünf Höfe aus verschiedenen Jahrhunderten gab. Der erste 12. und der letzte 19. Jahrhundert. Im ersten haben sie nur die Formen, die mit der Natur zu tun haben, und im letzten haben sie verkrampft versucht, alles nachzuahmen, wie es in einem echten Haus ist. Sie haben den Kamin nachgebaut, wie er in einem echten Haus ist … Alles, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber sie haben es in den Stein nachgebaut. Das wirkt auf den Menschen. Aber das sind frühere Menschen; deswegen zeitverzogen.“
„Das ist aber schön, dass du in Höhlen gelebt hast.“
„Jaa, das habe ich genossen. Das war zwischen 12 und 15. Es war eigentlich ein abgelegener Teil von einem Schloss, das an einem Hang lag und nicht mehr zum Schloss gehört hat. Das Haus ging über sechs Stockwerke vom Tal bis nach oben. Von draußen hat man also nur die Hälfte gesehen. Jeden Raum konnte man von drei verschiedenen Orten erreichen. Das wirkt nach.”
Wir runden unser Gespräch ab und ich erzähle Sylvain noch einmal von dem Büchlein, das Matthias Augsburg und Alexander Droste zum Online-Kongress geschrieben haben. Sylvain freut sich darauf, es zu lesen.
https://shop.tredition.com/booktitle/WEGE_in_eine_GEMEINWOHL_GESELLSCHAFT/W-930-798-694
„Wenn ich etwas lese, ist für mich die Frage nicht nur, ob es stimmt oder nicht, sondern wer geschrieben hat.“
„So wie ich dich heute Nachmittag verstanden habe, geht es auch gar nicht anders. Die Wahrnehmung vom anderen Menschen, die du ja hast, ob du willst oder nicht, du hast sie …“
Wir lachen.
„… aber dass es letzten Endes der einzelne Mensch auch immer mehr kapieren muss, was er in sich trägt, damit er dann den freieren Blick darauf haben kann. Das habe ich heute ganz stark mitgenommen. Und deswegen kann es dir nicht nur darum gehen, ob etwas richtig oder falsch ist, oder wie weit etwas von der eigentlichen Idee entfernt ist, oder ob es ein Irrweg ist, sondern du siehst diesen Menschen ja mit.“
„Ja. Ja. Und dadurch lerne ich auch über die Person.“
„Ja, und du lernst auch, das anderen Menschen weiter zu vermitteln.“
„Ja.“
Nun ist es Zeit für die Verabschiedung und ich strahle:
„Vielen herzlichen Dank für dein Gespräch. Wir kennen uns gar nicht und haben uns trotzdem so offen unterhalten. Vielen herzlichen Dank dafür.“
Hier geht es zu den vorherigen Beiträgen:
Teil 1: https://zukunftswerkstatt.events/sylvain-coiplet-ulrike-stein-teil1/
Teil 2: https://zukunftswerkstatt.events/sylvain-coiplet-8-8-2024-ulrike-stein-teil-2/